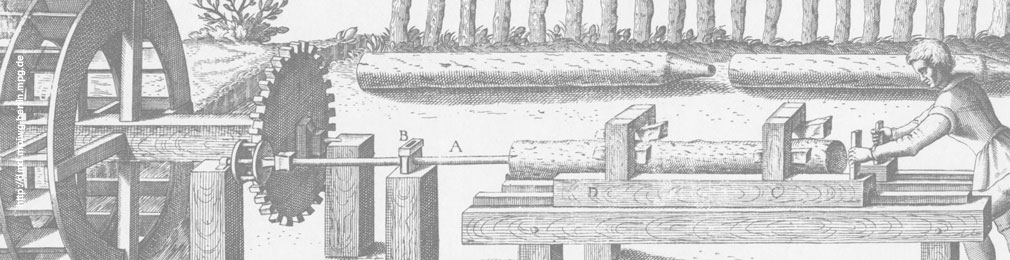Reto Flury
Maskierung des Schweizer Soldaten
Zu den waffentechnologischen Innovationen während des Ersten Weltkriegs gehören bekanntlich chemische Kampfstoffe wie Chlorgas, Phosgen oder Lost. Deren militärische und wissenschaftlich-technische Entstehungskontexte sind vor allem für den Fall von Deutschland gut erforscht. Dagegen sind die Gasmasken, die als technische Hilfsmittel bei Gaseinsätzen die Infanteristen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs kampffähig halten sollten, bisher noch kaum untersucht worden.
Der Beitrag geht davon aus, dass von den chemischen Kampfstoffen während des Ersten Weltkriegs, aber auch während der Zwischenkriegszeit ein technischer Anpassungsdruck ausging, den soldatischen Körper um eine Gasmaske zu erweitern. Das galt auch für Armeen in neutralen Staaten wie derjenigen der Schweiz, auch wenn sie zwischen 1914 und 1918 nicht in die Kampfhandlungen involviert war. Der Beitrag untersucht aus technikhistorischer Perspektive, wie die militärischen und politischen Akteure in der Schweiz während der 20er Jahre auf diesen Anpassungsdruck reagierten. Im Zentrum steht der Entwicklungsprozess des Gasmaskenmodells 33, der sich ab 1923 über eine Zeitspanne von zehn Jahren hinzog. Dieser Prozess wird auf zwei Ebenen analysiert: Auf der Akteur-Ebene und auf einer Diskursebene.
Auf dem Niveau der Akteure werden die lokalen Praktiken der involvierten Personen beschrieben, die allmählich zu einem labilen Netzwerk im Sinne Bruno Latours führten. Im Frühjahr 1923 lancierten Vertreter der Kriegstechnischen Abteilung (KTA) die Initiative, im Hinblick auf einen zukünftigen, möglichen Gaskrieg ein Schweizer Gasmaskenmodell zu entwerfen. Gegen anfängliche Widerstände aus der Verwaltung des Eidgenössischen Militärdepartements spricht die Landesregierung die notwendigen finanziellen Ressourcen. Um die Entwicklungskosten möglichst tief zu halten, knüpften die Chemiker nun Kontakte zu ehemaligen Reichswehroffizieren und Industrieunternehmen in Deutschland, die sich während des Ersten Weltkriegs im Rahmen der Gasrüstung technisches und wissenschaftliches Know-how angeeignet hatten. Gleichzeitig institutionalisierten die KTA-Wissenschaftler ihre Forschungsanstrengungen mit einem Gas-Laboratorium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Ab 1925 werden die ersten Prototypen der Masken an Rekruten getestet. Dabei taucht zunächst sporadisch, später dann in einer Kontroverse verdichtet die Frage auf, ob für den Widerstand eines Atmungsventils eine objektive Obergrenze existiert. Die negative Antwort begründen die forschenden Akteure damit, dass die soldatischen Körper mit einem geeigneten physiologischen Programm an diese Kampfbedingungen mit verminderter Luftzufuhr hin trainiert werden können.
An dieser Stelle setzt die Analyse auf einer Diskursebene ein. Es wird untersucht, nach welchen Regeln und diskursiven Mustern der Soldatenkörper in militärpublizistischen Schriften der Zwischenkriegszeit modelliert worden ist. Denn, so die Annahme, diese diskursiven Ordnungen ermöglichten es den Akteuren erst, sinnvoll über das Verhältnis von Gasmaske und dem bedrohten Soldatenkörper zu sprechen. Dabei wird sich zeigen, dass das spezifisch moderne Metapher des menschlichen Körpers als einer regulierbaren energetischen Maschine, als eines human motors (Rabinbach), den Rahmen steckte, innerhalb dessen sich ein funktionierender Körper mit einer Gasmaske denken liess.
Der Beitrag führt die Ansätze der Technikgeschichte und der Körpergeschichte zusammen. Die Aktor-Netzwerk-Theorie von Bruno Latour erlaubt, die Kontingenzen in einem technologischen Entwicklungsprogramm herauszuheben. Andererseits lässt sich mit einer von Foucault abgeleiteten Diskursanalyse die Beharrlichkeit von bestimmten Körpermodellen demonstrieren, die auch bei der Konzeption einer Gasmaske eine starke Bedingung darstellten.