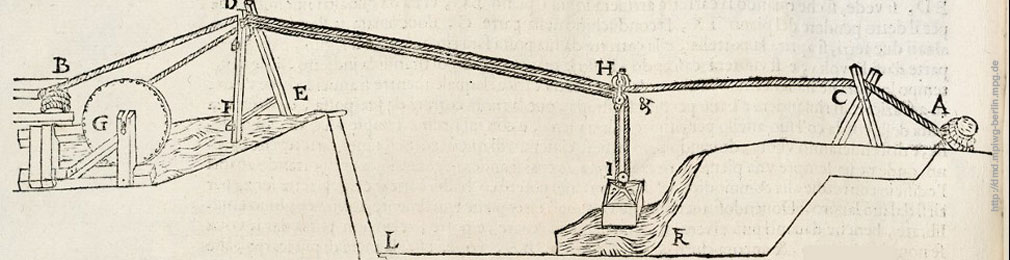Rudolf Schlaffer
Bundeswehrsoldat und Technik im Atomzeitalter 1955-1970
Das Verhältnis von Waffen und Soldaten beschränkte sich nicht nur auf den "heißen" Krieg, sondern umfasste auch die Vorbereitung auf den möglichen Fall. Der Kalte Krieg fand sowohl in der psychologischen Schulung, als auch in der Übung für den Bundeswehrsoldaten als realistischer Einsatz statt. Durch die Konfrontation der Blöcke war die Aufrüstung in Westdeutschland nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges ein politisches Erfordernis, das aufgrund der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine neue Armee und einen neuen Typus des Kriegers bedurfte. Mit der "Inneren Führung" wurde in der Bundeswehr eine Führungsphilosophie geschaffen, die in einer Person den Staatsbürger und den Soldaten vereint. In diesem geistigen Credo wurde der selbstverantwortliche, teamfähige Einzelkämpfer gefordert, der ein "Meister" an seinem Waffensystem werden sollte. Die Hauptwaffensysteme waren als sogenannte Abstandswaffen leistungsfähiger und technisch wesentlich ausgefeilter als die Vorgängertypen. Der Gegner verschwand immer mehr aus den Augen, aber nicht aus dem Ziel, und es drohte die völlige Vernichtung durch atomare Waffen. Der Soldat der Bundeswehr musste fortan das Gefecht unter zweierlei Prämissen führen können: (1) den konventionellen und (2) den atomaren Krieg. Aber selbst auf der ersten Ebene, dem konventionellen Krieg, war es erforderlich, sowohl als Einzelkämpfer auf dem Gefechtsfeld quasi als anachronistischer Krieger überleben zu können, als auch das Gefecht der verbundenen Waffen zu beherrschen. Und die Fähigkeit zum Einzelkämpfer musste jeder Soldat, sei es in der Kampftruppe oder als Kampfunterstützer, erlernen und anwenden können. Das veränderte Kriegsbild erforderte eine Synthese: sowohl einen "heroischen Kämpfer" als auch einen "technischen Dienstleister in seiner Funktion".
Der Kampf des Soldaten unter dem Einsatz von atomaren, biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen war für ihn und für die militärische Führung ein reales Szenario und ein realistischer Planungshorizont. "Die Atomwaffen des Feindes bedrohen alle Truppen und Einrichtungen zu jeder Zeit und an jedem Ort [...] Truppen können somit nur unter gewissen Bedingungen und zeitlich begrenzt, jedoch nicht auf die Dauer durch Atomwaffen ersetzt werden." In der Heeresdienstvorschrift "Truppenführung" 100/1 aus dem Jahr 1962 wurde das möglich Kriegsbild eindringlich beschrieben. Der Soldat der Bundeswehr musste den konventionellen Kampf unter dem Damoklesschwert von Massenvernichtungsmitteln führen. Schon der Truppenführer (ab Brigadekommandeur aufwärts) konnte mit Atomwaffen entscheidend in den Kampf eingreifen. Eine ungeheuere Belastung sowohl für den militärischen Führer als auch für den unmittelbaren Kämpfer, da ihm durch den Einsatz von eigenen Waffen auch die eigene Vernichtung drohen konnte; von den unzähligen zivilen Opfern gar nicht zu sprechen.
Insgesamt eine Verschiebung des Kriegs- und Soldatenbildes, wie sie gerade in der Früh- und Aufbauphase der Bundeswehr vollzogen wurde und daher zu starken Auswirkungen im Selbstverständnis und in der Menschenführung der Bundeswehr führte. Der Bundeswehrsoldat pendelte hier zwischen dem Vorbild der Wehrmacht und den Erfordernissen einer geistigen und technischen Innovationsphase in einem demokratischen Gesellschaftssystem. Die technische und geistige Rüstung waren daher untrennbar miteinander verbunden.