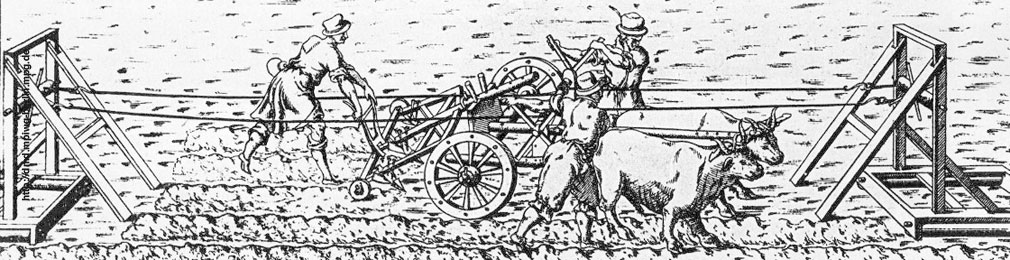Technik und Krieg
Veranstalter: Gesellschaft für Technikgeschichte (GTG) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Technikmuseum Berlin und dem Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Berlin-Gatow, Berlin
Datum, Ort: 05.05.2005-08.05.2005, Berlin
Bericht von: Anne Sudrow, Zentralinstitut für Geschichte der Technik, TU München
E-Mail:
Die letzte Generation des Wilhelminischen Deutschland „hatte noch Reiterdenkmäler errichtet, indes sie schon Auto fuhr. Sie hatte das Schwert zu ihrer Linken besungen, während sie das Giftgas zu ihrer Rechten erfand“.[1] In dieser Beobachtung eines Zeitgenossen von 1930 wird die grundlegende kulturelle Spannung beschrieben, die ein aus heutiger Sicht zentrales Motiv der historischen Technikforschung umreißt: die Diskrepanz zwischen den vorauseilenden, technischen Möglichkeiten einer hoch industrialisierten Gesellschaft und den fehlenden Konzepten und Mitteln eines angemessenen gesellschaftlichen Umgangs mit dem Neuen, dem technisch-konstruierten Anderen. Günther Anders nannte sie "das prometheische Gefälle". Diese Ungleichzeitigkeit galt umgekehrt aber auch zukunftsgewandt: Technikvisionen formten sich in den Köpfen der Akteure und bestimmten ihr Handeln, lange bevor sie in handfeste Artefakte umgesetzt wurden. Die Spannung der kulturellen Ungleichzeitigkeit wurde, wie ebenfalls im Zitat angedeutet, noch verstärkt durch den Krieg, in dem Techniken in ihrer gewalttätigsten und vernichtendsten Form den Menschen entgegentraten. Ihre Umsetzung und Reflexion, sei es direkt in den Handlungsspielräumen und „Sinnhaushalten“ der gesellschaftlichen Akteure, sei es indirekt in ihrer popularisierenden Deutung durch die Zeitgenossen und Nachgeborenen, war das Thema der Tagung „Technik und Krieg“ der Gesellschaft für Technikgeschichte, die vom 5. bis 8. Mai im Deutschen Technikmuseum in Berlin stattfand.
Insgesamt acht Sektionen beschäftigten sich an den vier Konferenztagen mit den Themen des Verhältnisses der Militärtechnik zur Ziviltechnik, mit verschiedenen Akteuren im Krieg, mit der Rüstung und Wissenschaftsorganisation im Nationalsozialismus, mit dem Luftkrieg als einer speziellen Form der Kriegführung sowie mit der Frage der Darstellung des Krieges in den Massenmedien und mit verschiedenen Aspekten einer Erinnerungskultur von Kriegen. Angesichts der Fülle von insgesamt 23 Vorträgen kann hier nur eine Auswahl vorgestellt werden. Wegen mehrerer gleichzeitig stattfindender Parallel-Sektionen muss z. B. das Panel über „Akteure“ ganz ausgespart werden, in dem Reto Flury (Zürich) über die Maskierung des Schweizer Soldaten, Brigitta Godt (Konstanz) über Frauen an Radargeräten und Stefan Kaufmann (Zürich) über die Disziplinierung des „digitalen Soldaten“ sprachen.[2]
Grenzen des Militärischen zum Zivilen
Zeitlich bewegte sich die Tagung vor allem im 20. und 21. Jahrhundert. Nur ein Referent, Daniel Arlaud (Paris), beschäftigte sich mit der frühneuzeitlichen Kriegserfahrung. Er stellte dar, wie das Schießpulver und mit ihm die Handfeuerwaffen als neue Art der Gewaltausübung im Dreißigjährigen Krieg durch Feldprediger, Militärchirurgen und Theoretiker der Kriegskunst als „unheldenhaft“ verdammt wurden, da sie anonymer wirkten als der Zweikampf und die Standesunterschiede innerhalb des Militärs unkenntlich machten. Den Aspekt des Söldnertums aufnehmend berichtete Dario Azzellini (Caracas) in einem bemerkenswerten Vortrag über die zunehmende Privatisierung militärischer Aufgaben an der Wende zum 21. Jahrhundert. War im ersten Irak-Krieg erst jeder hundertste Soldat ein Angestellter eines Privatunternehmens, so genannter „Private Military Contractors“, so war es im letzten Irak-Krieg bereits jeder zehnte. 250.000 US-Dollar kostet heute die Ausbildung so eines Kriegers an den neuesten Hightech-Waffen, dessen Tätigkeit nicht als militärische, sondern als bewaffnete zivile „Sicherheitsleistung“ bezeichnet wird, und der außerdem den „Vorteil“ hat, im Falle seines Todes nicht in den offiziellen Opferstatistiken aufzutauchen. Wolfgang König (Berlin) befasste sich ebenfalls mit der Frage des Verhältnisses vom Militärischen zum Zivilen, bezog sich dabei aber auf das Ende des l9. Jahrhunderts. Am Beispiel des Umgangs Kaiser Wilhelms II mit verschiedenen Bauprojekten, vor allem mit dem Bau des Mittellandkanals, der in Preußen nicht unumstritten war, untersuchte er die Möglichkeiten des „dual use“ dieser technischen Einrichtungen. Diese stünden im Kaiserreich in einem asymmetrischen Verhältnis: alle militärischen Projekte konnten zivil genutzt werden, aber nicht umgekehrt. Im Ergebnis bestätigte sich die absolute Dominanz des Militärischen im kaiserlichen Denken und bei seiner Förderung technischer Großprojekte.
Luftkrieg
Die Sektion zum Luftkrieg fand als Sondersitzung im Luftwaffenmuseum der Bundeswehr in Berlin-Gatow statt. Fernando Esposito (Tübingen) konstatierte in der populären Literatur aus der Zeit des Ersten Weltkrieges eine Marginalisierung der Technik in den Fremd- und Selbstbildern von Fliegern. Kriegsbücher wie etwa Manfred von Richthofens Memoiren vermittelten vom „Ritter der Lüfte“ eher das Bild eines kämpfenden Individualisten. Dieser wurde als an der adligen Leitkultur orientierter, mittelalterlich-romantisierender Gegenentwurf zum Massen-Infanteristen am Boden entworfen, der der Technik völlig ausgeliefert war. Tatsächlich bildeten auch die Flieger nur das letzte Glied in einer Kette der modernen, arbeitsteilig organisierten Kriegsführung. Von der Diskurs- auf die Praxisebene holte Christian Kehrt (Darmstadt) das Phänomen des Luftkampfes. Mit seinem methodisch sehr vielversprechenden Ansatz untersuchte er die Wirkungsweise des Ensembles von Mensch und Maschine am Beispiel der funktionalen Einheit der drei Elemente Pilot, Beobachter und Flugzeug. Ersterem wurde vor allem technisches und fliegerisches Können abverlangt, dem zweiten taktisches Verständnis und Führungspersönlichkeit als Offizier. Die technische Ausstattung verstand Kehrt dabei als „Gewaltdispositiv“, das eine spezifische Form des Handlungspotentials schaffe. Für die späten Fünfziger Jahre zeigte Bernd Lemke (Potsdam) an der Einführung der 960 Starfighter der amerikanischen Firma Lockheed in die westdeutsche Bundeswehr die enorme Abhängigkeit der BRD von transatlantischem Know-how in den Luftwaffensystemen, die in der öffentlichen Diskussion als großes Risiko gesehen wurde.
Technik und Wissenschaft im Nationalsozialismus
Der Zusammenhang von Technik und Wissenschaft im Nationalsozialismus nahm auf der Tagung insgesamt breiten Raum ein. Drei Vorträge widmeten sich dem 1937 gegründeten Reichsforschungsrat (RFR), und der Frage der Effizienz oder Ineffizienz der Wissenschaftsorganisation im Nationalsozialismus. Sören Flachowski (Berlin) arbeitete am Beispiel der Hochfrequenzforschung heraus, wie sich der RFR in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, ganz entgegen der bislang vorherrschenden Auffassung, die ihn als eher marginale Erscheinung im Kompetenz-Dschungel der Koordinationsinstanzen für die Rüstungsforschung sah, zu einer der bedeutendsten Institutionen der NS-Wissenschaftspolitik entwickelte. Günther Luxbacher (Berlin) wertete die Quellen zur Tätigkeit des RFR auf die Frage hin aus, wie viele Projekte sich mit Roh- und Ersatzstoff-Forschung, und damit im weiteren Sinne mit autarkiepolitischen Fragen, beschäftigten. Von den insgesamt bewilligten Projekten hatte im Nationalsozialismus jedes 5. Projekt die Erschließung neuer Rohstoffquellen und die Entwicklung „inländischer“ Werkstoffe zum Inhalt. Diese Zahl liege nicht etwa über, sondern noch unter der Anzahl der in der Weimarer Republik zu dem Themenkomplex bewilligten Projekte. Betrachte man jedoch allein die Rohstoffprojekte (ohne die Werkstoffe), so sei deren Anzahl im Nationalsozialismus auf das Doppelte der Weimarer Zeit gestiegen. Die privatwirtschaftlichen Industrieforschungen in den Unternehmen seien hier jedoch allgemein nicht mit eingerechnet, da sie nicht vollständig über die Quellen des Reichsforschungsrats erfassbar sind. Helmut Maier (Stuttgart/Berlin) wertete die Praxis der technisch-wissenschaftlichen „Gemeinschaftsforschung“ als das Erfolgsprinzip der Wissenschaftsorganisation im Nationalsozialismus. Gerade die dezentrale Form des „Ausschusses“ als interinstitutionelles Lenkungsgremium gestattete einen effektiven Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen, Militär und Forschungsinstituten. Auch ohne eine zentrale Steuerung durch eine einzige Institution sei so eine effiziente Mobilisierung der Forschungsressourcen für den Krieg gelungen.
Massenmedien und Kriegsdarstellung
Carsten Hennig (Braunschweig) beschäftigte sich mit den Massenmedien des Fernsehens und Kinos als Techniken der Überformung von Kriegsdiskursen. Aktuelle Hollywood-Filme wie The Last Samurai und Master and Commander verknüpften Darstellungen des Krieges mit Prozessen von Modernisierung und Evolution, in denen technologische Überlegenheit mit zivilisatorischem Fortschritt gleichgesetzt und kriegerische Auseinandersetzung als Teil natürlicher Kreisläufe dargestellt werde. Der Krieg gerate in diesen filmischen Fiktionen damit in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung, die Möglichkeit der Überwindung von Kriegen werde jedoch aus dem Kriegsdiskurs ausgeklammert. Unter einem ähnlichen Blickwinkel betrachteten Silke Fengler und Stefan Krebs (Aachen) die mediale Konstruktion des Ersten Weltkriegs in mehreren deutschen, dokumentarischen Fernsehserien. Mit der ungebrochenen Übernahme von Filmsequenzen aus dem damaligen Propagandamaterial, das sich auf die Inszenierung technischer Artefakte und wissenschaftlicher Forschung im Kriegsgeschehen konzentriert, transportierten die heutigen Dokumentarfilme einen falschen, da sehr verengten, Begriff von Modernisierung und vom „modernen Krieg“, der sich viel zu stark an die zeitgenössische Berichterstattung anlehnt, anstatt diese kritisch zu hinterfragen.
Aufschlussreich war im Anschluss an die Medienkritik von Seiten der Historikerinnen und Historiker die umgekehrte Sicht zweier praktizierender Filmemacher auf ihre eigene Arbeit. Nach der Wissenschaftsjournalistin Hanna Lehmbäcker (Berlin) verdeutlichte der Dokumentarfilmer Robert Gokl (Wien) anhand mehrerer exzellent ausgewählter Beispiele von filmischen Quellen, z.B. Amateuraufnahmen der Aufstellung einer V2 in Peenemünde und Privatfilmen des Hollywood-Regisseurs George Stevens von Dachau 1945, mit welchen Tücken und Lücken des Materials Filmemacher bei der Produktion ihrer Narrative zu kämpfen haben.
Erinnerungskulturen
In der Sektion „Erinnerungskulturen“ diskutierte Karsten Uhl (KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora) unter dem Titel „Deckgeschichten“ die Darstellung des Raketenbaus in den Erinnerungsberichten ehemaliger Häftlinge des KZs Mittelbau–Dora. Er stellte fest, dass die fortschrittsgläubige Grundannahme, das Böse bringe letztlich doch Gutes hervor, und die gedankliche Verbindung von V2-Produktion und dem bemannten Weltraumflug im Kalten Krieg für einige Häftlinge des KZs ebenso dominant war wie für die allgemeine Darstellung Wernher von Brauns in der Nachkriegszeit. Sie versuchten, durch die Referenz auf den „Griff nach den Sternen“ ihrem Leiden nachträglich einen Sinn zu geben. Einen bis in die Gegenwart reichenden Fall des Erinnerungsdiskurses stellte Katharina Hoffmann (Oldenburg) vor. Sie untersuchte die Praxis der Nutzung und Bandbreite von Möglichkeiten der „Umnutzung“, die derzeit im Umgang mit dem ehemals größten deutschen U-Bootbunker „Valentin“ in Bremen-Farge diskutiert werden.
Fazit
Ist die Technikgeschichte also wieder zu ihrem traditionellen Kernthema, dem Heraklit’schen Krieg als „Vater aller Dinge“ zurückgekehrt? Mitnichten. Nach Jahrzehnten der Überwindung und Erweiterung des engen, enthusiasmierten Ingenieurblicks auf die Errungenschaften der großen Männer und ihre (immer schneller, höher, weiter) fliegenden Maschinen ist es den mittlerweile sozialgeschichtlich geschulten und nach den kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen technischer Innovationen fragenden Historikerinnen und Historikern gelungen, den Blick auf den Krieg und auf die Umstände und Praktiken der technisierten Gewaltanwendung bedeutend zu vertiefen. Das zeigte die Tagung eindringlich und überzeugend.
Am deutlichsten wurde dies während des Vortrags von Stephan Huck vom neu gegründeten „Deutschen Marinemuseum“ in Wilhelmshafen. Hier regte noch einmal die schon tot geglaubte Hydra, die alte Ingenieursthese von der Neutralität der Technik, ihr altersmüdes, neuntes Haupt, als der Referent sein Konzept von der geplanten Ausstellung des ehemaligen Zerstörers „Werner Mölders“ vorstellte, der nunmehr in Wilhelmshafen als Museumsschiff vor Anker liegt. Da ging ein Raunen des Staunens und der Ungläubigkeit, ja der Empörung durch das versammelte Fachpublikum. Eine Ausstellung, in der die militärischen Hilfs-Einsätze des Zerstörers im ersten Golfkrieg und anlässlich des Balkankrieges gemäß der Marine-Sprachregelung unreflektiert als „Reisen“ bezeichnet werden? In der die Besucher vom Anspruch her „wertneutral“ mit der Geschichte dieses Artefakts konfrontiert werden sollen? In der die Tatsache, dass man sich auf einem Kriegsschiff befindet, ebenso unkommentiert gelassen wird wie der Namensgeber Werner Mölders, der Jagdflieger der „Legion Condor“, nach dem mittlerweile keine Kaserne in Deutschland mehr benannt werden darf? Da wurde selbst der harte Vorwurf einer „Bankrotterklärung“ der technikhistorischen Museumsarbeit laut. An den akademischen und musealen Standards und Praktiken zeitgenössischer Technikgeschichtsforschung gemessen muss eine solch kontextlose Darstellung von Waffentechnik mittlerweile als überholt angesehen werden.
Anmerkungen:
[1] Hans A. Joachim, Romane aus Amerika, in: Neue Rundschau 41 (1930), S. 397.
[2] Das Gesamtprogramm der Tagung ist unter hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=3689 einsehbar.